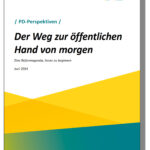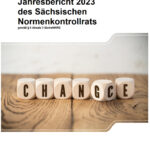E-Government in EuropaDer Blick gen Norden

Dänemark ist ein Leuchtturm bei der Digitalisierung.
(Bildquelle: juhumbert/adobe.stock.com)
Während in Deutschland die Verwaltungsdigitalisierung nur langsam vorankommt, setzen sich Estland und die skandinavischen Länder als Vorreiter immer weiter ab. Daher richtet sich der Blick aus Deutschland verstärkt auf diese Länder, in der Hoffnung von den dortigen Erfolgen lernen zu können; insbesondere mit dem Nachbarland Dänemark steht Deutschland im engen Erfahrungsaustausch. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der dänischen und der deutschen E-Government-Strategie bestehen und inwiefern der Blick in die Ferne die Verwaltungsdigitalisierung vor Ort tatsächlich positiv anstoßen kann.
Diesen Fragen geht die Kurzstudie „Nationale E-Government-Strategien: Deutschland und Dänemark im Vergleich“ des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums (NEGZ) nach. In der Studie werden die Nationale E-Government-Strategie Deutschlands und die dänische Strategie „A stronger and more secure digital Denmark“ als jeweils richtungsweisende und politikbestimmende Rahmenwerke analysiert und verglichen – sowohl mit Blick auf formale als auch auf inhaltliche Aspekte. Hieraus ergeben sich spannende Einblicke in Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Strategien und somit in die länderspezifischen Perspektiven auf die Verwaltungsdigitalisierung.
Historisch gewachsenes Verständnis von Digitalisierung
Bereits der formale Vergleich der Strategien zeigt, dass in Dänemark die Digitalisierung unter anderen Bedingungen diskutiert wird als in Deutschland. So ist die dänische Strategie für die Jahre 2016 bis 2020 die bislang letzte in einer Reihe von Strategien, die bis ins Jahr 2001 zurückreichen. Sie ist damit Teil eines historisch gewachsenen Verständnisses von Digitalisierung, verweist auf deren Potenziale und baut auf bisherigen Erfolgen auf. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass in der dänischen Strategie häufig auf bereits existierende, zentrale Lösungen verwiesen wird, die für weitere Maßnahmen genutzt und weiterentwickelt werden können – weil sie sowohl in der Verwaltung als auch bei Unternehmen und Bürgern bereits als geltender Standard akzeptiert sind.
Zentrale Systeme, welche die Digitalisierung in Dänemark tragen, sind die NemID und NemLogin, digitale Identifikationsmöglichkeiten für Verwaltungsdienstleistungen, Finanztransaktionen und private Dienstleister, Digital Post, eine landesweit genutzte Lösung zur digitalen und rechtssicheren Kommunikation mit Behörden, Borger.dk, ein zentrales Portal, über das Verwaltungsdienstleistungen bezogen werden können und schließlich NemKonto, über das Zahlungen an und von Behörden abgewickelt werden können.
Hohe Akzeptanz der Digitalisierungsmaßnahmen
Demgegenüber fokussiert die Nationale E-Government Strategie Deutschlands als Fortschreibung der ursprünglichen Strategie aus dem Jahr 2010 stark den Status quo der Verwaltungsdigitalisierung und schafft erst den Rahmen und die notwendige Infrastruktur dafür, die in Dänemark bereits gegeben sind. Zentrale Lösungen, auf denen weitere Maßnahmen und Initiativen aufbauen könnten, fehlen in Deutschland bislang oder werden – wie die eID oder De-Mail – nicht flächendeckend genutzt.
Entsprechend unterscheidet sich die inhaltliche Ausrichtung beider Strategien. In Deutschland thematisiert sie insbesondere Strukturen der Verwaltung und Aspekte des Datenschutzes sowie der Datensicherheit. Damit richtet sie sich eher nach innen, an Behörden und Entscheidungsträger in den Verwaltungen – wenngleich auch die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen explizit als Adressaten der Strategie aufgeführt werden. Im Fokus steht jedoch die Schaffung der notwendigen Infrastruktur.
Die dänische Strategie richtet sich zwar ebenfalls mit konkreten Maßnahmen an die Verwaltungen, ist aber stärker nach außen orientiert und kann als Marketing-Instrument verstanden werden, das nicht allein über die teils weitreichenden Digitalisierungsmaßnahmen informiert, sondern insbesondere Akzeptanz für und Vertrauen in diese Maßnahmen aufbauen soll. Immer wieder wird deshalb in der dänischen Strategie auf den nationalen Kontext verwiesen, der sich durch ein besonders hohes Vertrauen der Bürger in die Verwaltung und in elektronisch angebotene Dienstleistungen und damit eine insgesamt hohe Akzeptanz für Digitalisierungsmaßnahmen auszeichnet. Entsprechend häufig werden die Vorteile der Verwaltungsdigitalisierung für Bürger und Unternehmen herausgestellt oder auf das gesteigerte Innovationspotenzial für die Wirtschaft verwiesen.
Die unterschiedliche Sichtweise auf das Thema Digitalisierung zeigt sich auch am Blick beider Länder auf den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen Maßnahmen umgesetzt werden können. Während in Deutschland das Recht als Grundlage der E-Government-Strategie betrachtet wird und somit die vorgeschlagenen Maßnahmen bestimmt, wird der rechtliche Rahmen in Dänemark als etwas verstanden, das Digitalisierung ermöglichen und den vorgeschlagenen Maßnahmen angepasst werden sollte.
Was kann Deutschland von Dänemark lernen?
Was aber kann Deutschland bei so vielen Unterschieden noch von Dänemark lernen? Und wo müssen ganz eigene, neue Wege beschritten werden? Die offensichtlichen Unterschiede – etwa die Größe des Landes, die Kultur oder den Verwaltungsaufbau betreffend – ebenso wie weniger offensichtliche Unterschiede, die sich im Vergleich der Strategien beider Länder offenbaren, zeigen zwei Dinge deutlich: Zum einen sollten Entscheidungsträger, Verwaltungen und Regierungen den nationalen Kontext, in dem Digitalisierungsinitiativen stehen, stärker hervorheben und berücksichtigen. So verlockend der Blick gen Norden und in jüngster Zeit auch gen Osten ist, so schwierig ist es, Lösungen aus Dänemark oder – wie zuletzt von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gefordert – aus Estland auf Deutschland zu übertragen. Denn in der Analyse der dänischen Strategie wird deutlich, dass diese Länder ein anderes Grundverständnis von Digitalisierung, deren Zweck sowie vom Verhältnis zwischen Staat und Bürgern haben. Teilweise ist dies auch in der jeweiligen nationalen Kultur begründet und verankert. Lösungen, die für die eine Kultur und Gesellschaft funktional und praktikabel sind, müssen in einem anderen Kontext nicht zu vergleichbaren Ergebnissen führen.
Zum anderen zeigt sich, dass ein Austausch auf internationaler Ebene gerade zwischen Vorreitern und Nachzüglern dann fruchtbar und richtungsweisend sein kann, wenn dabei nicht nur Erfolge und Best Practices in den Blick genommen werden, sondern auch Worst Practices. Denn längst nicht jedes Vorhaben lässt sich erfolgreich umsetzen. Mit Blick auf die lange Historie der Verwaltungsdigitalisierung in Dänemark ließen sich durchaus nützliche Erkenntnisse gewinnen. Versuche, mit denen das Land gescheitert ist, könnten die Digitalisierung in Deutschland inspirieren, ohne sie als Blaupause zu begreifen.
https://www.ercis.org
Dieser Beitrag ist im Spezial der Ausgabe August 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
https://negz.org
Bund: Open Source bevorzugt
[26.07.2024] Eine Anpassung am E-Government-Gesetz hat der Bund verabschiedet. Demnach soll der Nutzung von Open Source Software in der Bundesverwaltung künftig Vorrang eingeräumt werden. mehr...
OZG-Änderungsgesetz: Reform tritt in Kraft
[26.07.2024] Es ist der Schlusspunkt unter einem aufwendigen Verfahren: Mit Inkrafttreten des OZG-Änderungsgesetzes ist die Reform des Onlinezugangsgesetzes nun abgeschlossen. mehr...
Bundesagentur für Arbeit: Zugang zu eServices mit BundID
[23.07.2024] Leistungen der Arbeitsagenturen, Jobcenter und Familienkassen können jetzt mit der BundID beantragt werden. mehr...
Bayern: Verwaltung muss arbeitsfähig bleiben
[15.07.2024] Bayerns Digitalminister sieht die konsequente Digitalisierung der Verwaltung als wichtige Möglichkeit, um den künftigen Ruhestand der Babyboomer-Generation und den dadurch entstehenden Fachkräftemangel zu kompensieren. Es gelte, die Potenziale von Standardisierung, Zentralisierung und KI zu nutzen. mehr...
OZG-Rahmenarchitektur: Ergebnisbericht zur Konsultation
[15.07.2024] Im Rahmen der Erarbeitung eines Zielbilds für die künftige gemeinsame OZG-Rahmenarchitektur hat von Oktober 2023 bis Januar 2024 ein begleitender und partizipativ gestalteter Konsultationsprozess stattgefunden. Dessen Ergebnisse liegen jetzt vor. mehr...
SEMIC-Konferenz: Kooperation für ein interoperables Europa
[12.07.2024] Auf der diesjährigen SEMIC-Konferenz, die unter dem Motto „Interoperable Europe: From Vision to Reality“ in Brüssel stattfand, stellte Staatssekretär Markus Richter seine Vision eines interoperablen Europas vor. Dieses fußt auf einer engen Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Digitalisierungsbereich. mehr...
Bundesrat: Mehr Druck beim DigitalPakt 2.0
[11.07.2024] Mit dem DigitalPakt Schule hat der Bund Länder und Kommunen bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur unterstützt – bis Mai dieses Jahres. Nun verhandeln Bund und Länder über die Anschlussfinanzierung. Im Bundesrat sprachen sich die Länder für eine verlässliche Fortführung bis 2030 aus. mehr...
PD: Reformagenda für den Public Sector
[09.07.2024] In einem Strategiepapier entwirft das Beratungsunternehmen PD ein Zielbild für den Public Sector von morgen. Um den Public Sector zukunftsfähig zu machen, reichen demnach Einzelmaßnahmen nicht aus. Daher will PD vier große Reformbereiche mit einem umfassenden Ansatz adressieren. mehr...
Digitales Bayern: Der Sound der Zukunft
[05.07.2024] Bayern segelt auf Innovationskurs, sagt Fabian Mehring. Kommune21 sprach mit dem Digitalminister des Freistaats über die Reorganisation seines Ressorts, seine Pläne für einen innovativen Staat und die Rolle der Kommunen dabei. mehr...
eGovernment Benchmark 2024: Nutzerzentrierung ist der Schlüssel
[05.07.2024] Laut dem jüngsten eGovernment-Benchmark-Report der Europäischen Kommission haben die europäischen Staaten bei der Bereitstellung digitaler Behördendienste stetige Fortschritte gemacht. Raum für Optimierungen gibt es insbesondere bei grenzüberschreitenden Diensten und bei Dienstleistungen, die von regionalen und kommunalen Behörden erbracht werden. mehr...
Rheinland-Pfalz: Neue Digitalministerin ernannt
[03.07.2024] Neue Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz wird Dörte Schall. Der bisherige CIO/CDO der Landesregierung, Fedor Ruhose, soll Chef der Staatskanzlei werden. mehr...
Thüringen: Zehn Millionen Euro für kommunale Digitalisierung
[02.07.2024] Das Land Thüringen will die kommunale Digitalisierung mit zehn Millionen Euro fördern. Das geht aus der neuen Thüringer E-Government-Richtlinie hervor, die jetzt offiziell veröffentlicht wurde. Gefördert werden unter anderem digitale Fachverfahren und Schnittstellen, IT-Sicherheits-Maßnahmen und die interne Prozessoptimierung. mehr...
Bürokratieabbau: Jahresbericht des Sächsischen Normenkontrollrats
[01.07.2024] Mit der Erfüllungsaufwandsdarstellung neuer Regelungen soll der Sächsische Normenkontrollrat zu mehr Transparenz beitragen und Erkenntnisse zum Bürokratieabbau in Sachsen wie auch im bundesweiten Vergleich liefern. Nun liegt der Jahresbericht für 2023 vor. mehr...
Cloud-Strategie: Bundeskanzleramt verwirft Deutsche Verwaltungscloud
[27.06.2024] Mit einem ungewöhnlichen Schritt brüskiert das Kanzleramt alle Initiativen rund um die Deutsche Verwaltungscloud und drängt die Bundesländer zu einem Vertragsabschluss mit Delos, einer in Deutschland betriebenen Variante der Microsoft Azure Cloud. mehr...
IT-Planungsrat: Weichenstellung für modernen Föderalismus
[20.06.2024] Als zentrales Steuerungsgremium für die Digitalisierung der Verwaltung gestaltet der IT-Planungsrat den organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung. In seiner letzten Sitzung traf das Gremium weitreichende Beschlüsse, die bei der Umsetzung zu mehr Tempo und Effizienz führen sollen. mehr...