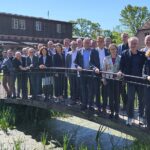DatenschutzEin scharfes Schwert
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der vergangenen Woche entschieden, das Privacy Shield genannte Datenschutzabkommen mit den USA zu kippen. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dürfen personenbezogene Daten nicht in Drittländer übermittelt werden, die kein angemessenes Datenschutzniveau besitzen. Vor dem Hintergrund des Patriot Act von 2001, der einen Zugriff der US-Geheimdienste auf den transatlantischen Datenverkehr ermöglicht, und des Cloud Act von 2018 hat der EUGH nun die Rechtmäßigkeit des Privacy-Shield-Abkommens negiert. Der Datenschutz erweist sich somit als scharfes Schwert in den transatlantischen Beziehungen.
Hintergrund ist eine Beschwerde des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems. Der Jurist hatte bei der irischen Datenschutzbehörde beanstandet, dass Facebook Ireland seine Daten an den Mutterkonzern in die Vereinigten Staaten auf Basis des Abkommens zwischen der EU und den USA weiterleitet. Nachdem der EuGH diesen Weg nun aufgrund der Rechtslage in den USA versperrt hat, gelten weiterhin die so genannten Standardvertragsklauseln. Der EuGH unterstreicht in seinem Urteil nochmals, dass demzufolge Verantwortliche und Auftragsverarbeiter prüfen müssen, ob die Standardvertragsklauseln in einem Drittland eingehalten werden. Auch die Datenschutzaufsichtsbehörden werden verpflichtet, dies zu beurteilen.
Verstöße gegen geltendes Recht
Laut dem Verband der IT-Anwender VOICE, in dem Unternehmen wie Airbus, Allianz, Lufthansa, RWE oder Thyssen Krupp vertreten sind, setzt die Regelung europäische Unternehmen dahingehend unter Druck, dass sie ihre Verträge mit Cloud-Providern dringend überprüfen und die Daten nun verschlüsseln müssten. Die Datenübermittlung in die USA werde illegal. Vom Privacy Shield betroffen seien im Prinzip fast alle europäischen Unternehmen, die ihre Daten von US-Cloud-Anbietern verarbeiten lassen und zum anderen Unternehmen, die personenbezogene Daten ihrer Kunden zum Beispiel an Mutter- oder Tochterunternehmen weiterleiten oder die aus anderen Gründen personenbezogene Daten in die USA transferieren. Das gilt auch für die großen Social Networks und Suchmaschinenanbieter, welche die Daten von EU-Bürgern sammeln und in die USA übermitteln.
Ähnliches drohe auch den so genannten Standardvertragsklauseln, die europäische Unternehmen in ihre Verträge mit US-Providern aufnahmen, als 2015 der Vorgänger von Privacy Shield, das Safe-Harbour-Abkommen, vom EuGH gekippt worden und Privacy Shield noch nicht in Kraft war. „Wenn auch diese schon immer rechtlich umstrittenen Standardvertragsklauseln nicht mehr rechtmäßig sind, fehlt der Übermittlung personenbezogener Daten in die USA auch diese Rechtsgrundlage“, lautet die Einschätzung des VOICE-Verbands. Jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten in die USA ohne Rechtsgrundlage übermittelt, verstoße gegen geltendes Recht, was empfindliche Strafen nach sich ziehen kann.
Keine schnelle Lösung in Sicht
Der Verband zweifelt die Möglichkeit einer kurzfristigen, rechtmäßigen Alternative an und empfiehlt deutschen und europäischen Unternehmen, zu überprüfen, ob ihr Daten-Management-System in der Lage ist, sämtliche Datenströme im Detail zu monitoren, da sie jederzeit Aussagen dazu treffen können müssen, wo personenbezogene Daten verarbeitet und gespeichert werden. Zudem sei es notwendig, sämtliche Verträge mit US Cloud-Providern und mit Providern, die ein signifikantes US-Geschäft haben, zu überprüfen. Im Zweifelsfall dürften dem Provider nur verschlüsselte Daten anvertraut werden und die Schlüssel ausschließlich in den Händen des eigenen Unternehmens sein.
Von der Bundesregierung und der EU-Kommission fordert der VOICE-Verband, ein verbindliches Datenschutzabkommen mit den USA zu schließen, das ein ausreichendes Datenschutzniveau garantiert, damit Unternehmen wieder legal personenbezogene Daten in die USA übermitteln können. „Ansonsten befürchten wir, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Europa schweren Schaden nehmen“, heißt es in einer Stellungnahme. Geeignet dazu sei, den Aufbau einer europäischen Cloud-Infrastruktur voranzutreiben und damit die digitale Souveränität und Unabhängigkeit der Europäer zu erhöhen.
Mehrarbeit für den Datenschutz
Von kommunaler Seite wird das EuGH-Urteil unmissverständlich begrüßt. Wie der Bundesverband der kommunalen IT-Dienstleister, Vitako, mitteilt, müssten die Datenschutzbehörden in der EU nun ihrer Verpflichtung nachkommen, Datenübermittlungen in Drittländer zu prüfen und zu unterbinden, wenn sie der Auffassung sind, dass die europäischen Datenschutzvorgaben nicht erfüllt werden. Unternehmen wie Behörden hätten jetzt die Aufgabe, das Urteil praktisch anzuwenden. „Alle Nutzer von Software und Diensten amerikanischer Hersteller sowie Dienstleister müssen nun prüfen, ob die bisherigen Verträge weiterhin rechtskonform sind, das heißt, im Einklang mit der DSGVO stehen“, sagt Vitako-Geschäftsführer Ralf Resch. „Die kommunalen IT-Dienstleister schauen mit großem Interesse und positiver Erwartungshaltung auf die weiteren Schritte der europäischen Datenschutzbehörden.“
Gesetzgebung: Mehr Praxisnähe für den Digitalcheck
[01.07.2025] Der Digitalcheck sorgt dafür, dass neue Gesetzesvorhaben auch digital umsetzbar sind. Die darin formulierten Grundprinzipien für digitaltaugliches Recht wurden überarbeitet, um die Anwendung in der Praxis zu erleichtern und um europäische Vorgaben zu integrieren. mehr...
Saarland: Zwischenfazit zur Modernisierung der Landesverwaltung
[27.06.2025] Das Saarland zieht Bilanz zur bisherigen Reform der Landesverwaltung. Wesentliche Fortschritte gab es bei Bauordnung, digitaler Bildung und interner Digitalisierung. Zudem gelten ab dem 1. Juli neue Wertgrenzen für die Vergabe, welche die Beschaffung vereinfachen. mehr...
IT-Planungsrat: Wichtige Weichenstellung für die Digitalstrategie
[27.06.2025] Bei seiner letzten Sitzung hat der IT-Planungsrat erste Projektvorhaben der föderalen Digitalstrategie beschlossen. Zugleich gab das Gremium grünes Licht für das Umsetzungsprogramm einer einheitlichen föderalen Postfach- und Kommunikationsinfrastruktur und begrüßte zwei neue Mitglieder. mehr...
Schleswig-Holstein: Steuerung für den Open-Source-Einsatz
[27.06.2025] Das Land Schleswig-Holstein geht beim Umstieg auf digital souveräne, quelloffene IT-Lösungen weiter voran. Eine neue Koordinierungsstelle soll den strategischen Einsatz von Open-Source-Software steuern – auch in der heimischen Wirtschaft. mehr...
Bund/Nvidia: Weitreichende Kooperation
[18.06.2025] Deutschland soll führender Standort für KI-Forschung, -Entwicklung und -Anwendung werden. Bundeskanzler Friedrich Merz und Nvidia-CEO Jensen Huang haben in einem persönlichen Gespräch eine Kooperation vereinbart, die zum Aufbau einer starken KI-Infrastruktur beitragen soll. mehr...
Rheinland-Pfalz: Zwischenbilanz zur Digitalisierung
[03.06.2025] Auf dem Strategietag in Worms zog Rheinland-Pfalz eine positive Zwischenbilanz zur Umsetzung der Digitalstrategie: 73 Prozent der Maßnahmen laufen, 20 Prozent sind abgeschlossen. Der Austausch diente auch der Weiterentwicklung der Strategie für 2026 und 2027. mehr...
Bund: Grundlage für Once-Only beschlossen
[03.06.2025] Das Bundeskabinett hat dem NOOTS-Staatsvertrag zugestimmt. Das Gesetzgebungsverfahren startet nun auf Bundesebene. NOOTS soll eine technische Infrastruktur schaffen, über die Behörden Verwaltungsdaten sicher austauschen können. mehr...
Hessen: Grüner Gesetzentwurf für KI in der Verwaltung
[28.05.2025] Die Grünen im Hessischen Landtag haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Rechtssicherheit für die KI-Nutzung in der Verwaltung schaffen will. Automatisierte Entscheidungen sollen dauerhaft ermöglicht, Beschäftigte entlastet und Transparenz für Bürgerinnen und Bürger sichergestellt werden. mehr...
Deutschland/Frankreich: Starke digitale Partnerschaft
[27.05.2025] Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat sich in Berlin mit Frankreichs Digitalministerin Clara Chappaz getroffen. Beide kündigten an, gemeinsam den Aufbau einer europäischen Digital Public Infrastructure und eine innovationsfreundliche KI-Politik voranzubringen. mehr...
Bundestag: Grundsatzrede zur Digitalpolitik
[20.05.2025] Digitalminister Karsten Wildberger sieht in der Verwaltungsmodernisierung einen Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands – und stellt im Bundestag konkrete Pläne für Infrastruktur, Datenpolitik und digitale Identitäten vor. mehr...
Thüringen: Eine neue CIO für das Land
[16.05.2025] Die Unternehmerin Milen Starke – zuvor geschäftsführende Gesellschafterin beim IT-Dienstleister Q-Soft – wird neue Staatssekretärin für Digitales und CIO des Landes Thüringen. Damit wird die Vakanz nach dem Ausscheiden des bisherigen CIO Hartmut Schubert neu besetzt. mehr...
Digitalministerkonferenz 2025: Impulse für die digitale Zukunft
[15.05.2025] Auf der 3. Digitalministerkonferenz wurden unter anderem Beschlüsse gefasst, um die digitale Souveränität in Europa zu stärken. Im Fokus standen außerdem die Weiterentwicklung der politischen Rahmenbedingungen für Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Auswirkungen von KI auf Demokratie und Meinungsbildung. mehr...
IT-Planungsrat: Erfolgreiche Klausurtagung
[14.05.2025] Bei seiner Klausurtagung in Mecklenburg-Vorpommern diskutierte der IT-Planungsrat wichtige Weichenstellungen in der Verwaltungsdigitalisierung und Staatsmodernisierung. Im Fokus standen die Registermodernisierung und die Weiterentwicklung der Deutschland-Architektur. mehr...
Schleswig-Holstein/Dänemark: Digitale Souveränität in Europa stärken
[13.05.2025] Schleswig-Holstein verfolgt als erstes Bundesland eine Open-Source-Strategie, um digitale Abhängigkeiten in der Landesverwaltung konsequent zu reduzieren. Digitalminister Dirk Schrödter war nun nach Dänemark eingeladen, um vor dem Parlament über den Weg seines Landes in die digitale Souveränität zu sprechen. mehr...
Thüringen: Erste Sitzung des Digitalbeirats
[12.05.2025] Thüringen hat seinen neuen Digitalbeirat offiziell eingesetzt. Er soll die Landesregierung als fachkundiges und unabhängiges Gremium beraten. Zum Auftakt ging es vor allem um digitale Souveränität. mehr...